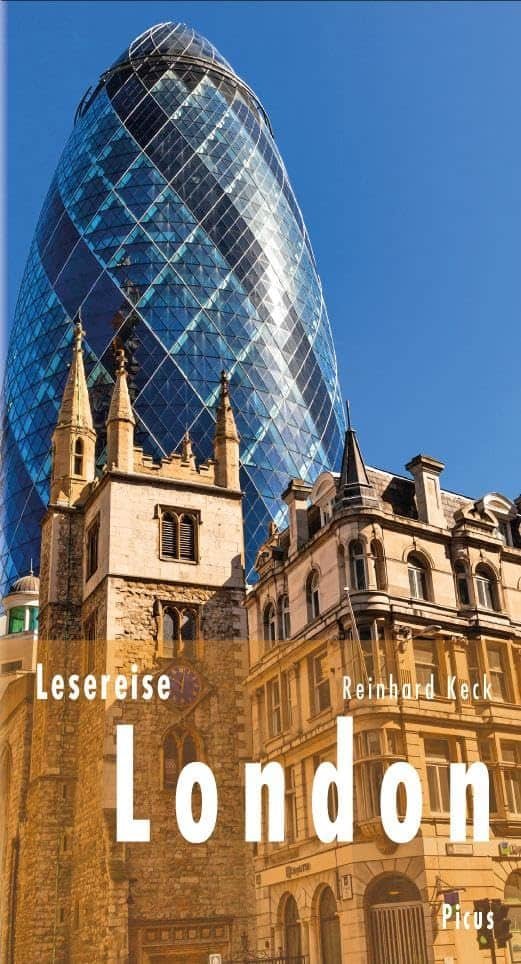Im Sommer 2015 reiste ich durch die Ukraine, von Kiew bis ans Asowsche Meer, nahe der russischen Grenze. Wie steht es um das Land, nach dem Schock der Maidan-Revolution? Um das herauszufinden, traf ich Aktivisten, Rentner, Soldaten, Liebespaare und Freischärler. Die Reportage erschien in Bild am Sonntag.
–
In summer 2015 I traveled through Ukraine, from the capital Kiev all the way to the Russian border. I wanted to find out: How does the country deal with the aftershock of the Maidan revolution? To find answers I met people from all walks of life: activists, soldiers, pensioners, lovers, vigilantes. My report was published and commissioned by Bild am Sonntag.

Der vergessene Krieg
Seit fast zwei Jahren tobt in der Ukraine ein blutiger Konflikt. Tausende Menschen sind umgekommen, Millionen wurden vertrieben. Ein Roadtrip durch ein verstörtes Land
Der Weg in den Krieg führt direkt am Meer entlang, vorbei an einem Strand mit weißem Sand und klarem Wasser. Friedlich wirkt die verlassene Badebucht, doch unsere Begleiter macht der Anblick nervös: „Scharfschützen!“ knurrt einer. „Weg hier“, sagt der Fahrer und gibt Gas.
Gemeinsam mit Kämpfern einer ukrainischen Bürgerwehr brettern wir in einem alten VW-Bus über eine Schotterpiste Richtung Front. Wir fahren in das idyllisch gelegene Dorf Schirokino am Asowschen Meer, im äußersten Osten der Ukraine.
Seit Monaten kämpfen ukrainische Truppen und prorussische Separatisten um den Ort. Schirokino ist nur ein Kriegsschauplatz von vielen in der Ukraine. 6500 Menschen sind seit dem Ausbruch des Konflikts vor anderthalb Jahren gestorben, zwei Millionen sind aus ihrer Heimat geflüchtet. Separatisten halten weiter Teile des Landes besetzt.
Dennoch ist der Konflikt aus den Schlagzeilen verschwunden. Griechenland-Krise und ISIS-Extremisten bestimmten zuletzt die Schlagzeilen. Dabei bezeichnen Politiker und Sicherheitsexperten den Brandherd in der Ukraine noch immer als größte Gefahr für Frieden und Stabilität in Europa.
Wie erleben die Menschen den Alltag und das Chaos im Jahr eins nach der Maidan-Revolution?
Um das herauszufinden, sind wir durch die Ukraine gereist: Von West nach Ost, vom Maidan-Platz über die Südküste bis an die Front. Die Fahrt in das umkämpfte Dorf Schirokino war die letzte Etappe unserer Reise in den Krieg. Begonnen hatte der Trip einige Tage vorher in der Hauptstadt Kiew.
Fitnessclub „Kachalka“ in Kiew: 800 km bis zur Front

Goldbraune Körper glänzen in der Abendsonne. Muskeln beben, Zähne knirschen: Das „Kachalka“ ist ein riesiges Fitnessstudio unter freiem Himmel, ein „Muscle Beach“ am Ufer des Dnepr-Flusses. Hier pumpt Kiew Kraft, jeden Tag, seit 60 Jahren schon.
Auch Sasha (58) hält sich fit und stemmt eine mit Autoreifen beschwerte Eisenstange. Der pensionierte Fabrikarbeiter klagt: „Es ist alles teurer und schwieriger geworden. Ich bin enttäuscht.“
Tatsächlich steckt die Ukraine in einer schweren Wirtschaftskrise: Arbeitslosigkeit, Gas- und Benzinpreise steigen, der Wert der Landeswährung Hrywna hat seit Ausbruch der Krise zwei Drittel an Wert verloren. Das trifft besonders Rentner wie Sasha. Für ihn hat die Maidan-Revolte vor allem Ernüchterung gebracht.
Anton (29) sieht das anders, er arbeitet als Tontechniker beim Fernsehen. Wir treffen ihn am Abend auf der Truchaniw-Insel, einem Stadtstrand, auf dem jeden Abend Sommerfeste steigen. Anton hat am Maidan seinen Zeigefinger verloren, als er eine Gasgranate wegwerfen wollte.
„Unser Kampf darf nicht umsonst gewesen sein“, meint er. „Wir wollen in Freiheit leben und zu Europa gehören. Dafür brauchen wir Kraft und Geduld.“
Später spazieren wir zum Maidan-Platz. Eine Limousine braust heran, Mädchen lehnen aus den Autofenstern, schwenken Champagner-Gläser und jubeln uns zu. An diesem Abend erscheint die Ukraine lebensfroh: Ein Land zwischen Krise, Krieg und Sommer- Party.
Plattenbau-Siedlung in Saporischschja: 230 km bis zur Front
Endlich zu Hause. Yura (35) umarmt seine Frau Tatjana und küsst sie im Schein der Parkplatz-Laterne. Yura ist Scharfschütze beim „Freiwilligen-Bataillon Donbass“. Jeden Samstag trampt er nach Hause, in die Industriemetropole Saporischschja, wo Frau und Tochter auf ihn warten.
Heute haben wir ihn ein paar Kilometer mitgenommen. Eigentlich ist Yura Schreiner, dass er in den Krieg gezogen ist, daran ist auch Ehefrau Tatjana schuld. Sie sagte, er solle auf den Maidan gehen und gegen die Polizei kämpfen, statt vor dem Fernseher herumzuhängen.
„Und das hatte ich dann davon“, sagt Yura scherzend, krempelt seine Hose hoch und zeigt eine faustgroße Narbe: „Eine Granate ging direkt neben mir hoch.“
Mittlerweile würde Tatjana den Patriotismus ihres Mannes lieber etwas bremsen. Doch Yura will sein Vaterland jetzt erst recht verteidigen, auch gegen die Widerstände seiner Eltern: „Mein Vater ist Kommunist. Er unterstützt Russland und die Separatisten. Seit einem Jahr haben wir keinen Kontakt mehr.“
Der Konflikt, er treibt nicht nur einen Keil durch das Land, er spaltet auch Familien. Ob sie irgendwann wieder Frieden schließen?
Yura sagt: „Was an der Front passiert, wird uns verändern. Wir werden nicht einfach in unser altes Leben zurück können.“
Strand von Berdjansk: 110 km bis zur Front
Den ganzen Tag lag Viktoria (27) in der Sonne, ihre Haut ist tief gebräunt. Vor einigen Wochen flüchtete sie aus der von russischen Rebellen besetzten Stadt Donezk, nun liegt sie am Strand und genießt den Sommer. „Jeder Moment des Friedens ist kostbar in diesen Zeiten“, sagt sie.
Nur ihr Bruder ist zurückgeblieben er kämpft jetzt für die Separatisten. Für Scharfschütze Yura und seine Kameraden ist er damit ein „Kreml- Söldner“, ein „Putin-Scherge“ und Verräter. Viktoria aber fürchtet um das Leben ihres Bruders, sie hatte schon lange keinen Kontakt mehr mit ihm.
„Ich habe Angst, dass wir uns nie wiedersehen werden“, sagt sie.
Wohngebiet in Kramatorsk: 84 km bis zur Front
Alina Wassilina kommen die Tränen, wenn sie auf ihren Balkon schaut. Sie kann noch immer nicht fassen, wie knapp es war, wie viel Glück sie hatte. Im Februar trafen völlig unerwartet Raketen ihren Wohnblock, abgeschossen aus den Rebellen-Gebieten.
13 Menschen starben, doch die Rakete, die in Alinas Balkon und Wohnzimmer einschlug, hatte einen defekten Zünder. Fast sechs Monate später ist die ehemalige Aeroflot-Mitarbeiterin trotzdem frustriert.
Die Schäden wurden immer noch nicht beseitigt, die Schuld gibt sie der Regierung in Kiew: „Wir müssen wie Heimatlose bei Bekannten leben. Dabei hat Kiew versprochen, Geld für die Reparaturen von Kriegsschäden zu schicken. Doch es passiert nichts.“
Ein Nachbar klagt: „Das alte System haben sie verjagt. Doch die Korruption ist geblieben.“

Mülldeponie in Slowjansk: 75 km bis zur Front
Der große Kommunisten-Führer liegt mit dem Gesicht im Gras, am Rande einer Mülldeponie.
Anfang Juni hatten Andreij (31) und seine Mitstreiter im Morgengrauen die alte Lenin-Statue vor dem Rathaus abgesägt und weggeschafft. Es war eine Nacht-und-Nebel-Aktion, man wollte die Russland-Freunde nicht provozieren.
Der Plan ging auf: „Nur ein paar Babuschkas kamen und haben Radau gemacht“, erklärt der Geschäftsmann zufrieden. Seit Kurzem gilt in der Ukraine ein Anti-Kommunismus-Gesetz: Es verbietet nicht nur Sowjet-Symbole, auch Filme, in denen Russland positiv dargestellt wird.
Das empört viele Ostukrainer, die Russisch sprechen und sich dem Nachbarn verbunden fühlen. Andrej findet diese Art der Vergangenheitsbewältigung „nicht tragisch“. Er hält sie sogar für lukrativ: Die aus hundert Prozent Bronze bestehende Statue des Kommunisten-Führers bietet er zum Verkauf an. „Für 150 000 Euro gehört sie dir“, sagt er.
Checkpoint in Mariupol: 26 km bis zur Front
Warum gibt man einen gut bezahlten Job als Projektmanager auf, verlässt Frau, Kind, Haus und Heimat, um für 61 Euro Sold im Monat sein Leben zu riskieren?
Es ist eine Frage, die sich vielleicht nur Außenstehende stellen können. Andrej (31) jedenfalls hat sofort eine Antwort parat: „Lieber kämpfe ich hier und jetzt gegen die Terroristen, bevor sie vor meinem eigenen Haus stehen.“
Der Computerfachmann sitzt an einem Checkpoint direkt am Strand nahe der Hafenstadt Mariupol und beobachtet, wie seine Kameraden vom „Bataillon Donbass“ im Meer planschen. Stolz präsentieren die Kämpfer ihre Tätowierungen: Einer hat sich die Umrisse der Ukraine auf den Rücken stechen lassen, ein anderer hat einen brennenden Molotow-Cocktail auf den Bauch.
Ein paar Meter weiter haben sie Schützengräben am Strand ausgehoben und Schilder aufgestellt, die vor „Minen“ warnen. Mariupol liegt zwischen der von Russland besetzten Halbinsel Krim und dem Separatisten- Gebiet – schon lange fürchtet man daher eine Invasion. Doch nicht alle haben Angst: Eine Frau im Bikini breitet neben einer Panzersperre ihr Badetuch aus, und ein Kind baut neben dem Stacheldrahtzaun unbekümmert eine Sandburg.

Zerstörte Jugendherberge in Schirokino, 0 km bis zur Front
Zurück im Dorf Schirokino: Unser VW-Bus biegt um eine scharfe Linkskurve, vom Traumstrand ist nichts mehr zu sehen, stattdessen eine Landschaft aus Ruinen, zerstörten Häusern, Bombenkratern und Bergen aus Schutt und Trümmern.
Die Scharfschützen des „Bataillon Donbass“ blicken durch Löcher in der Mauer einer alten Jugendherberge auf die Stellungen der Separatisten. Sie sind nur ein paar Hundert Meter entfernt. Ein Kämpfer mit dem Spitznamen „Drakoscha“ („kleiner Drache“) erklärt: „Die Waffenruhe, die sie mit Putin vereinbart haben, das ist ein Witz. Die gab es hier nie.“
Über die Beobachter der OSZE spottet ein Milizionär namens „Douglas“: „Die sind so überflüssig wie eine Nonne im Puff.“
Vor wenigen Tagen haben die Rebellen das zerstörte Dorf einseitig zur „entmilitarisierten Zone“ erklärt. Nun belauern sich die feindlichen Lager. Keiner will zurückweichen. Man verschanzt sich, holt Luft und wartet ab – bis wieder einer anfängt zu schießen.
Ein Sinnbild für die Lage an den anderen Fronten im Land. Der Konflikt zersplittert Volk und Gesellschaft: Patrioten gegen Terroristen, Enttäuschte gegen Regierende, Russland-Hasser gegen Kommunisten, Vergangenheit gegen Zukunft, Väter gegen Söhne.
Wen man auch fragt, jeder kann ein Feindbild benennen. Doch wie dieser Irrsinn beendet werden soll, dazu scheint niemandem etwas einzufallen, außer vielleicht: geduldig sein, weiterkämpfen.
„Schnell, ins Haus“, ruft plötzlich ein Kämpfer. Irgendjemand hat einen feindlichen Funkspruch belauscht und schlägt Alarm. Alle greifen zu den Waffen und setzen die Helme auf. Gespanntes Warten. Doch nichts passiert.
Eine halbe Stunde später ist ein Donnerschlag zu hören, doch nun bleiben die Kämpfer gelassen. „Sommergewitter“, sagt Drakoscha. Dann greift er nach dem Maskottchen der Truppe, einem Katzenbaby, das erschrocken unter einen Tisch gesprungen ist.
„Gewöhn dich dran, Kleines“, flüstert der Kämpfer dem Tier ins Ohr: „Das Schlimmste kommt vielleicht erst noch.“